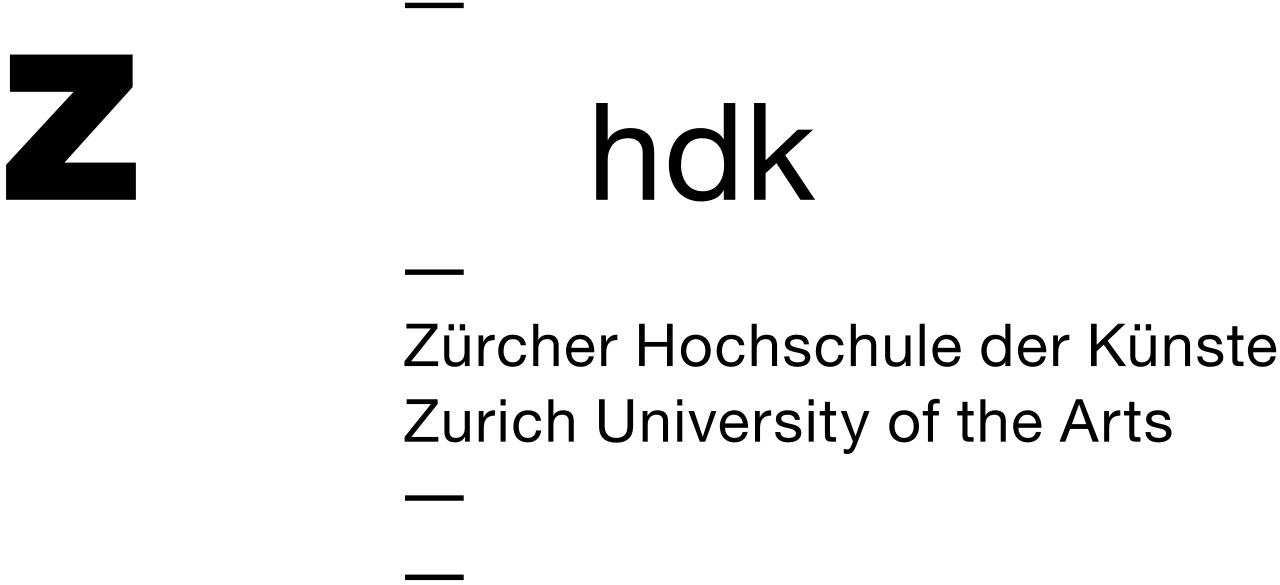Wenn die Eibe flüstert
Voller Vorurteile schaut unsere Autorin auf den Rechberggarten, ein Überbleibsel aus der Barockzeit. In der Hoffnung, die «Zürich-Zeit» zu verlassen, tritt sie ein – und in Verbindung mit einer alten Eibe.

Der Rechen bürstet den Kies und glitzert im Licht. Hart trifft auf hart, Metall auf Stein. Es chräscheret, während die weichen Pflanzenresten vom Grau entfernt werden. Dass ich mich nach einem strengen Uni-Tag an einem öffentlichen Ort aufhalte, ist ungewöhnlich und meiner Freundin Emma zu verdanken. Sie meinte, nur in diesem Garten könne sie dem Sog der Zürich-Zeit entkommen.
Bisher durchquerte ich den Barockgarten Rechberg voller Vorurteile. Schliesslich trägt er das Erbe vom Versailles des Sonnenkönigs weiter, der alle Sümpfe trockenlegen und jedes mit Buchs umrandete Beet mit exklusiven Blumen bestecken liess. Im Grunde ereignet sich hier, was der französische Philosoph Henry de Saint-Simon als «das stolze Vergnügen, der Natur Gewalt anzutun» bezeichnete, ce plaisir superbe de forcer la nature.
Ich begegne dem Garten, als würde er auch mich in sein enges Korsett zwingen – und das tut er gewissermassen auch. Die Wege, die ich gehe, und die Blicke, die ich schweifen lasse, folgen den symmetrischen Linien, denen die Natur sich unterwerfen muss. Wenn die Natur dieser strengen Disziplin folgt, dann reiss du dich gefälligst auch zusammen, scheint der Garten mir zu sagen. Das klingt nicht nach einem Ort, an dem ich bleiben will. Ich suche nach Gänseblümchen, die an den Rändern der Beete in sie hereinwuchern und die starre Ordnung durchbrechen.
Nun sitze ich auf einer Terrasse und lasse meine Beine über die Krone eines Spaliers baumeln. Das fühlt sich ungewohnt an. Normalerweise strecken sich die Äste der Bäume bis in die Wolken, während ich mit meinen Füssen am Boden festklebe. Jetzt könnte ich mit meinem Absatz die jungen Triebe des Birnbaums unter mir kitzeln, ich könnte aber auch seine Blüten pflücken oder junge Äste abreissen. Er könnte sich nicht wehren. Ihm werden ständig die Arme gekürzt, sodass er nie höher greifen kann als bis zur Terrasse. Der Birnbaum lehnt sich an die steinige Mauer unter der Terrasse. Er teilt sich wie eine Heugabel und wächst an zwei stählernen Kabeln entlang, nach rechts und links niemals nach vorne. Ihm wurde in der Baumschule beigebracht, nur in zwei Dimensionen zu wachsen. Ich stelle mir die entsprechend flachen Birnen vor, die er hervorbringen müsste. Ein von breiten Kernen eingedrücktes Esspapier in der Form der Birne, aber nicht im Inhalt. Ceci, n’est pas une poire. Nur zum visuellen Verzehr, müsste auf dem Schild stehen. Die Stimme der Gärtnerin unterbricht meinen Gedankengang. Sie weist zwei Frauen darauf hin, dass die Früchte der Obstspaliere nicht zum Essen gedacht sind. Ich erhasche einen Blick auf eine unförmige Kugel in der Hand der einen Frau. Die Kugel ist zu einer dreidimensionalen Bratbirne gereift.
Als ich aufstehe, schweift mein Blick über die höher gelegenen Terrassen. Mich starren regelmässig angeordnete und zu Buntstiftspitzen zugeschnittene Eiben an. Wie strenge Schachfiguren regieren sie und verteidigen die Gartenkunst des Rechbergs gegen die ökonomische Denkweise des 21. Jahrhunderts. Wäre der Garten nicht unter Denkmalsschutz, würden hier wohl Immobilien spriessen und gute Steuerzahler*innen anlocken.
Der Mond erhebt sich über dem Garten und die letzten Sonnenstrahlen lassen die Blumenbeete leuchten. Die zwei Frauen werden von der Ferne verschluckt und mit ihnen die verbotene Frucht. Der Garten schliesst seine schmiedeeisernen Tore um neun Uhr. Zeit zu gehen. An der Tramhaltestelle Neumarkt legt sich die Müdigkeit wie ein schwerer Mantel um mich. Mein Blick bleibt an den verschnörkelten Ornamenten auf der Holztür des Palais Rechberg hängen. Das Tram fährt ein, ich bleibe stehen.
Die Ameisen klettern an meinem Stamm in ihre Nester hinab, um nach dem langen Tag zu ruhen. Ich horche auf, denn durch meine Wurzeln unter dem Kies spüre ich ein grösseres Lebewesen, das gezielt auf mich zukommt. Es nimmt zwei Treppenstufen auf einmal, als wären wir alte Bekannte, als müsste es mir dringend etwas erzählen. Es ist das Menschenwesen, dessen sezierenden Blick ich vorher auf mir spürte. Als wäre ich eine gemeisselte Statue, als könnte jeder Schnitt des Gärtners an mir bemängelt werden. Nun steht das Lebewesen neben mir und blickt mit mir, nicht auf mich. Ob es sich versöhnen will?
Unsere Blicke wandern über die Stadt. Wir atmen gemeinsam, das Lebewesen atmet seine Sorgen in die Abendluft hinein. Ich beginne, eine kleine Geschichte zu spinnen. Ich schüttle mein zähes Nadelkleid und das Lebe-Wesen wird wachsam.
Wir Eiben altern ohne Eile, jedes Jahr wachsen wir gemächlicher. Diese Lebensweise hat sich für uns bewährt. Meine ältesten Verwandten sind seit fünftausend Menschenjahren hier und wir kennen die Geschichten der Flüsse und Berge, die noch viel länger hier sind als wir.
Das Lebewesen setzt sich neben mich, neugierig. Ihr Menschen habt das Zuhören verlernt, flüstere ich ihm zu. Ihr wuselt und wuchert überall. In den Millisekunden Lebenszeit, die euch bereitsteht, bestaunt ihr eure Umwelt, nur um sie zu zähmen und schliesslich zu zerstören.
Ich lasse die Sirenen, das Vogelzwitschern und die Partymusik von der Uni zu einer beruhigenden Umweltsuppe verschmelzen. Ich sende einen Impuls an meine Wurzel, die sich unter dem Lebe-Wesen in die Erde schlängelt. Der Impuls fliesst in den linken Fuss des Lebe-Wesens. Das Lebe-Wesen lässt seinen Kopf neben mir auf den Rasen gleiten. Meine Ruhe sickert durch meine Wurzeln in seine Haut. Der Wind trägt das Taxin aus meinen Nadeln in einer feinen Dosis zu ihm. Es hat die Augen geschlossen, hört ein feines Surren in den Fingerspitzen und sein Herz in den Ohren. Einzelne Ameisenschritte kitzeln die Fussgelenke. Seine Haut wird kalt vom Schweiss. Das Lebe-Wesen ruht. Ich sende Bilder einer anderen Zeit.
Ein Schweizer Wald im Mittelland. Pferde, Menschen und Bäume. Die Pferde in ledernes Zaumzeug eingepackt, scharren ungeduldig im Laub. Um den Hals tragen sie breite Bänder, an denen Seile befestigt sind. Einige von uns Bäumen sind schon tot. Die Menschen sind mit riesigen Sägen gekommen, mit denen sie zu zweit eine Fichte bearbeiten. Die Pferde warten. Später sollen sie die Stämme zu den Wohnorten der Menschen schleppen.
Ein ungeduldiges Pferd wendet sich einem knorrigen Baum mit immergrünen Nadeln zu, der im Schatten der grösseren Artgenossen wächst. Seine blättrige Rinde lädt mit ihrem süssen Geruch zum Anknabbern ein. Der Baum ist eine Eibe, wie ich. Das Pferd isst und isst und weil Genuss ansteckt, essen bald alle Pferde mit. Die Menschen sägen achtlos weiter. Doch als die Fichte endlich fällt, fallen mit ihr die Pferde. Von der Eibe vergiftet.
Ich flüstere nicht mehr, ich heule, ich klage: Die Menschen weben eine Geschichte, in der die Eiben das Böse darstellen, in der die Eiben die Pferde ermorden. Den Eiben muss demnach dasselbe widerfahren wie den Pferden. Und so beginnen die Menschen uns Eiben auszurotten, um wieder Gerechtigkeit herzustellen.
Der Wind weht über meine Nadelpracht. Ich horche auf und spüre die altbekannte Vibration der Gummistiefel der Gärtnerin. Sie packt das Lebewesen unter meinen Armen und zerrt es Richtung Tor, einige Minuten bevor der Garten schliesst. Sie wirft mir einen vorwurfsvollen Blick zu: «Nicht schon wieder.»
Der Rechberggarten gilt als letztes Relikt des spätbarocken Gartenbaus in Zürich. Seit er 1899 in Besitz Kantons kam, wurde er mehrfach restauriert. Die typisch barocke Formensprache wird durch 47 Eibenkegel, die Kieswege, die Spaliere, die Zäune und Hecken, die Kübelpflanzen und die Buchshecken aufgenommen. Viele andere Elemente wie die Bänke, die Abfalleimer und auch Bepflanzung der Beete, sind an unsere Zeit angepasst. Disclaimer: Der Autorin geht es gut.
Spezialausgabe
Libell 25: so gesehen
Rosa Zimmermann arbeitet beim B-Sides Festival, schreibt fürs null41 und studiert aktuell nach einem BA in Philosophie und Politikwissenschaften Kulturpublizistik an der ZHdK.