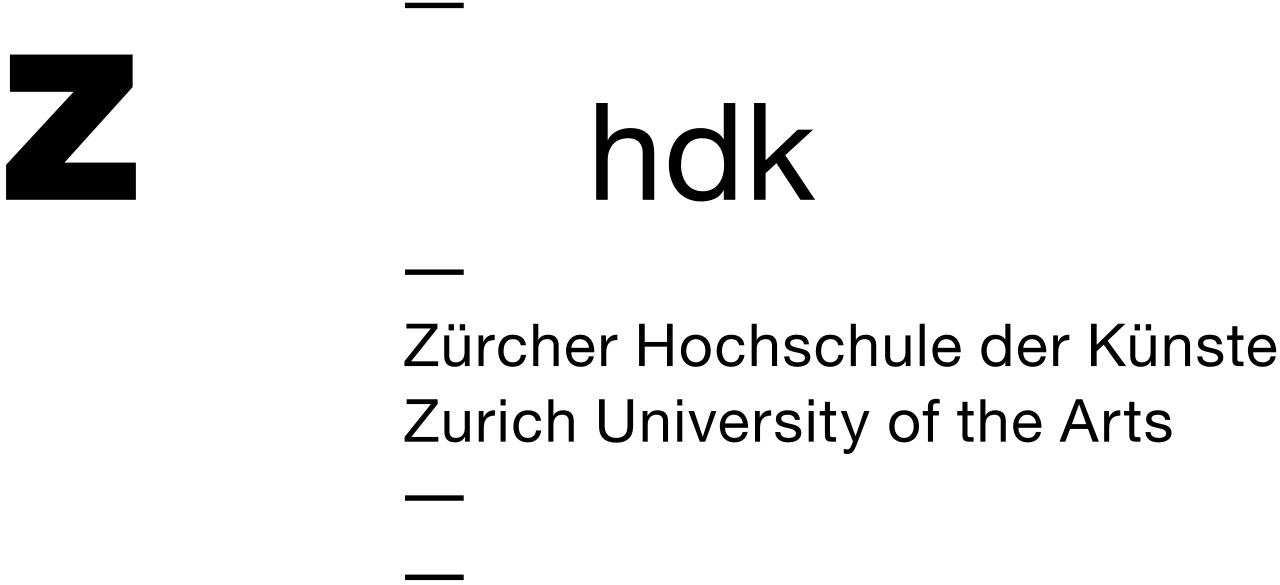Versuch, einen Friedhof wieder-zubeleben
Ein Spaziergang zum alten Krematorium im Zürcher Sihlfeld, vorbei an Sphingen und schwitzenden Jogger*innen.

Zürichs grösster Park ist ein Friedhof. 228’000 Quadratmeter Grünfläche, Kieswege – dekoriert mit Sitzbänken, Grabsteinen, Kolumbarien, Kerzen, Porzellanbildern. Seit 1958 sind die Grünflächen des Friedhofs Sihlfeld öffentlich zugänglich. Menschen sollen darin schlendern, spazieren, divagieren. Mit seiner Weite ist dieser Friedhof eine gute Alternative zum Waldspaziergang. Und wie jeder Wald birgt auch dieser Friedhof seine Geheimnisse. Einige ruhen im Untergrund, das Grösste aber thront in Teil D.
Vielleicht hast du dich bloss verlaufen, wenn du eigentlich zum Albisriederplatz wolltest. In dem Fall: Kehre um und halte dich rechts. Du stehst wohl gerade auf dem Platz des Trostes vor dem Triumphportal, über dem eine Frauenskulptur wacht. Architekturbanausinnen fühlen sich hier augenblicklich nach Paris oder Berlin versetzt. Aber so falsch ist das gar nicht: Zwar gibt es in Zürich das Viadukt bei der Hardbrücke oder den imposanten Eingang des Hauptbahnhofs – aber keinen Triumphbogen im klassischen Sinne. Die Portalwächterin hinter dir gelassen, schreitest du nun eine lange Kastanienallee entlang, vor dir wird das alte Krematorium sichtbar. Es ragt majestätisch empor und wirkt wie aus der Zeit gefallen. Das alte Krematorium stellt so manches Zürcher Wahrzeichen in den Schatten. Schau es dir mal an! Doch diese Stadt versteht sich gut darauf, Baudenkmäler zu verstecken – auf dem Friedhof zum Beispiel.
Über der Kuppel des Krematoriums ragt am Horizont der Uetliberg hervor. Je weiter du dich dem Hauptgebäude näherst, desto grösser werden die beiden Sphingen, die den Innenhof bewachen. Findest du sie auch so unheimlich? Ihre Löwenkörper sind kräftig und die Augen ihres menschlichen Gesichts durchbohren dich mit Blicken, wenn du zwischen ihnen passierst. Falls dir der Eintritt gebilligt wurde, stehst du nun im Herzen des Innenhofs. Im achteckigen Wasserbecken schwimmen mehrfarbige Koi – das Wasser trüb und grün. Links und rechts wirst du von zwei Urnenhallen umschlossen, während zwei Widderblumentöpfe und eine Freitreppe den Weg zum Eingangsportikus weisen. Die zwei Säulen tragen die Kuppel des Abdankungs- und Versammlungsraumes. In den Portikusecken krümmen sich die Reliefs mit trauernden Menschen unter der Last des Dachs. Über ihnen wurde in Stein gemeisselt:
FLAMME, LÖSE DAS VERGÄNGLICHE AUF. BEFREIT IST DAS UNSTERBLICHE.
Diese Flammen brannten einst auch in diesem Verbrennungsofen – das erste Mal am 26. Februar 1915, als hier die erste Feuerbestattung stattfand. Der Bau eines Krematoriums stiess damals auf erheblichen gesellschaftlichen Widerstand. Die Praxis des Kremierens ist zwar uralt und lässt sich mit der Idee der Wiederverkörperung der Seele gut vereinbaren, doch die christliche Kirche hatte irgendwann ein Problem damit. Sie warf der Feuerbestattung antichristliche Werte vor. Im Jahr 785 n. Chr. wurde die Erdbestattung auf dem Friedhof zur einzigen legalen Bestattungsform erklärt. Du kannst dir wohl vorstellen, dass die Hexenverbrennungen des Mittelalters auch nicht gerade zur Popularität der Feuerbestattung in dieser Epoche beitrugen. Erst während der Aufklärung begann man wieder mit dem Gedanken zu liebäugeln. Neue chemisch-physikalische Erkenntnisse, der unerschütterliche Glaube an den Fortschritt sowie die Angst vor überfüllten Friedhöfen führten dazu, dass ein Verbrennungsofen zur Notwendigkeit wurde. Und so kremierte man bald auch in Zürich bei 700 bis 800 Grad Celsius. Diese hohe Temperatur sorgt dafür, dass der Körper samt Sarg vollständig verbrannt wird. Es bleiben nur Knochenreste übrig, die anschliessend zu Asche zerkleinert werden. Wobei der Leichnam nicht von Flammen, sondern von heisser Luft zu Asche wird. Und wie wusste man, dass wirklich der oder die Angehörige verbrannt wurde? Dank eines kleinen Fensters im Sarkophag konnte man auf Wunsch beim Prozess zuschauen.
Wenn man auf der Freitreppe des alten Krematoriums Zürichs sitzt, muss man nicht zwingend an die Praktik des Kremierens oder an den Tod denken. Dennoch ist man sich bewusst, wo man ist. Man kann die Energie des Ortes spüren – spätestens, wenn einen die Sphingen ins Visier genommen haben.
Obwohl hier Menschen Tag und Nacht ein- und ausgehen und den Friedhof beleben, ist diese Umnutzung von Friedhöfen als soziale Räume nicht respektlos gegenüber dem Tod. Es ist wohl unangebrachter, wenn Friedhöfe abgeschottet am Rande der Stadt liegen und nicht zum Verweilen einladen. Die Transformation des Friedhofs in eine Parkanlage ist laut dem amerikanischen Soziologen Harold Garfinkel mehr als ein planerischer Entscheid – vielmehr gleicht sie einem ethnomethodologischen Experiment. Garfinkel zeigte mit seinen sogenannten Krisenexperimenten, dass alltägliche Regeln erst dann sichtbar werden, wenn man sie bricht. Wer auf einem Friedhof joggt, telefoniert oder lacht, rührt an die stillschweigende soziale Ordnung – und führt uns so vor Augen, wie wandelbar unsere Vorstellungen von Tod, Raum und Respekt sind. Es ist schön, wenn man sich auf Friedhöfen mit dem Tod auseinandersetzen kann, aber nicht muss. Zudem hat eine Auseinandersetzung mehrere Gesichter.
Friedhöfe bieten Raum für Kontemplation. Umso wichtiger ist es also, dass die Friedhöfe einen zentralen Platz in der Stadtplanung bekommen oder zumindest verdiente Aufmerksamkeit. Nicht nur, weil das alte Krematorium eines der schönsten Gebäude der Stadt ist. Nicht, weil es überbewerteten Kolonialherren die Show stehlen sollte (aber eigentlich schon auch deswegen). Sondern, da Orte der Erinnerung, der Trauer und der Spiritualität belebt sein sollen. Trauer ist nicht gleich Isolation. Friedhof ist nicht gleich Weinen. Im alten Krematorium werden schon lange keine Abdankungen mehr gefeiert und Menschen kremiert, es gibt Führungen und Apéros, Raves – interessante Ansätze. Im Vestre Friedhof in Kopenhagen wurde ein therapeutischer Garten eröffnet, in Berlin Neukölln wird Gemüse neben alten Gräbern angebaut und in Zürich wurden QR-Codes am alten Krematorium angebracht, um auf das Denkmal essayistisch aufmerksam zu machen.
Spezialausgabe
Libell 25: so gesehen
Adriana Lienert-Saéz geht gerne auf Friedhöfen spazieren, am liebsten wenn sie menschenleer sind. Sie studiert im Major Kulturpublizistik.