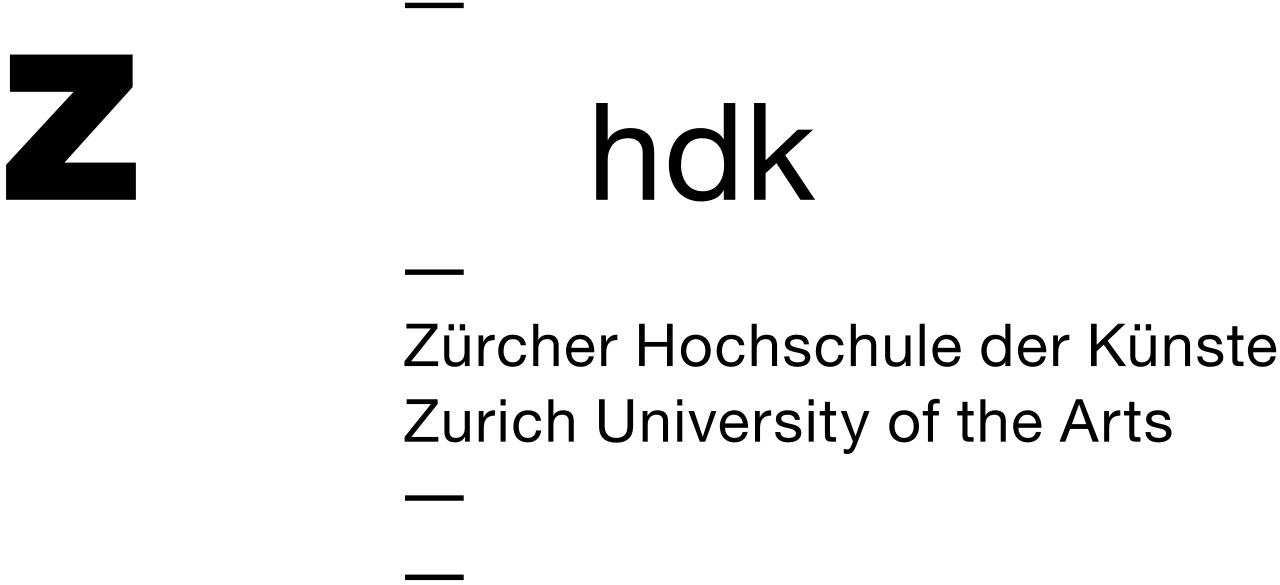«Trucs» oder der Versuch, ein Haus zu schreiben
Der «Waldgarten», einst als Restaurant und Quartiertreffpunkt im Zürcher Kreis 12 bekannt, ist seit Jahren eine kurzfristige Zwischennutzung – was danach kommt, ist ungewiss. Die Autorin lebt seit dreieinhalb Jahren da.

Als ich im Waldgarten ankam, war das Haus bereits voll. Es war voll von oben bis unten, voll wie jede meiner Umzugskisten. Vorsichtig schleppte ich meine Dinge durch die engen Gänge in den ersten Stock hinauf, unsicher, ob das Haus das alles überhaupt noch tragen kann.
In der Zeit danach war ich bei unzähligen Räumungsaktionen dabei, bei Umzügen, Wasser-, Wind- und Brandschäden, beim Reparieren und Aufräumen nach Partys und Einbrüchen, beim Traubenpflücken unter der Pergola im Spätsommer. Die Dinge kamen und gingen. Und meine eigenen Dinge wucherten, fügten sich ein in das Dinggeflecht dieses Hauses, bis sie zum Haus selbst wurden.
So schrieb ich mich in das Haus ein – und das Haus sich in mich. Oder: ich schrieb und es schraubte, ich schrubbte, es schaute.
Das Haus schaut mir beim Schreiben ständig über die Schultern.
Mittlerweile weiss ich: die Dinge, die mich beim Schreiben umgeben, schreiben sich in mein Schreiben ein. Und: das Sammeln und Anordnen von Dingen beim Wohnen sind wie das Sammeln und Anordnen von Wörtern beim Schreiben.
Ein Haus ist eine Art Beutel, der allerlei Dinge beinhaltet, schreibt Ursula K. Le Guin 1986 in ihrer «Tragetaschen-Theorie der Fiktion». Ich frage mich: was für ein Ding ist das Haus selbst? Und wenn das Schreiben doch meistens ein Schreiben über Dinge ist – wie kann ich dieses Haus nicht bloss zum Objekt, zum Ding meines Schreibens machen, sondern es als Ding für sich schreiben?
Erster Versuch: das Inventar
Wenn das Haus beispielsweise all die Dinge wäre, die es birgt, könnte ich versuchen, es durch sein Inventar zu schreiben:
Teppiche (26 Stück, unterschiedliche Grössen)
Märchenbuch («Das Restaurant, darin sich Schicksale kreuzen»)
Zerbrochenes Riesen-Ei in einer Holzschatulle (ca. 30x30x30cm)
Post ans Restaurant (Einladung zu einer Weindegustation, 10.04.2025)
Hutsammlung (bestehend aus 16 Hüten und Helmen)
Industrieabwaschmaschine (defekt, dreiteilig)
Eingefrorene Suppe (2 Gläser)
Notizbüchlein mit dem Titel TRUC
Bronzenes Set von Kelchen und einem Krug (siebenteilig)
Zeitmaschine aus Karton (Wanddekoration, flach, dreiteilig)
Glaslampenschirm/Früchteschale (Gewicht ca. 3kg)
…
Aber wo würde das Haus dann anfangen, wo enden? Was ist mit dem Brettern, die an ihm festgeschraubt sind, mit den Rissen in der Decke, dem Moos auf dem Balkon? Dazu kommt, dass «Inventar» und «erfinden» (aus lat. inveniō) die gleiche etymologische Herkunft haben. Kann dem Inventar also getraut werden?
Zweiter Versuch: vom Ding aus gehen
Eine andere Möglichkeit wäre, vom Kleinen aus zu gehen: Ich nehme ein einzelnes Ding aus dem Inventar heraus – Notizbüchlein mit dem Titel TRUC – und betrachte es genauer. Braun-rötlich, dünn und leicht zerknittert liegt es in meiner linken Hand, mit der rechten blättere ich es vorsichtig auf. In blauer Kugelschreiber-Schrift steht da: «x Ereignisse & Informationen & Gesichter FLUT durch Objekthafte Dinge verstauen / Kategorisieren – ordnen / die Suche nach dem Begriff für das, was ich will, ich bin. Kisten suche, keinen Text, sondern Gebrabbel mit Truc, dings etc. / Welle von Kisten auf die Protagonist:in / Dinge erhalten Gefühle?» Neben den Notizen finden sich Skizzen eines Storyboards, hinter Seite dreizehn ist das Büchlein leer.
Ob TRUC (französisch «Ding») von diesem Haus handelt und ob es jemals zu einem anderen Ding geworden ist, kann ich nicht sagen. Aber es ruft ein Gefühl in mir hervor, etwa so, wie es die Dinge in Gertrude Steins «Tender Buttons. Zarte knöpft» (1914) tun, materiell, brockenhaft, unmittelbar: das Haus ist so voll.
Wie – das heisst auch wo – schreibe ich dieses Haus?
Dritter Versuch: blaupausen
Geht das von meinem Schreibtisch aus? Vielleicht muss ich mich zum Schreiben an alle möglichen Orte des Hauses hin verlagern: in den Asphaltgarten, da, wo sich die Sonne am Morgen hinstreckt und am Abend die Abgaswolken verpuffen, unter den Dachvorsprung zwischen die Kisten voller Komposterde? Oder im Innern auf die Treppe nach oben, ans Fenster zum Waldrand, auf den Doppelherd in der Chromstahl-Küche? Ich frage mich: kann ich das Haus sprachlich blaupausen? In Le Guins Kurzgeschichte «Texte» (1990) kommen der Protagonistin Johanna messages aus allen möglichen Dingen entgegen – aus dem Boden, den Wellen im Meer, dem Tischtuch, aus ihrem Spitzenkragen – und meistens ohne, dass sie diese genau versteht, oder noch rechtzeitig. Vielleicht verhält es sich auch so mit diesem Haus. Ich lese in den Wellen des Vorhangs im Bad: umiu’i numuniu. Ich lese im Riss an der Wohnzimmerdecke: s-az-z-vx-wzaz. Doch diese messages verändern sich ständig – ein Windstoss, ein Donnern – und das Haus müsste immer wieder von vorne geschrieben werden.
Vierter Versuch: Überlieferungen
Ich könnte damit beginnen, was ich über das Haus weiss: Gebaut im Jahr 1880, diente der Waldgarten über ein Jahrhundert lang als Restaurant – ein grosser Schriftzug an der Fassade erinnert heute noch daran. Die letzten Restaurantbesitzer:innen waren Kurt und Rosmarie Schnetzer, berühmt für ihre «Nüdeli» – hausgemachte Pasta an Bolognese-Sauce – und ihren Weinkeller. Vom Balkon im ersten Stock schaute eine lebensgrosse Plastikkuh auf die Strasse hinunter.
Dazu kommen die Erzählungen derer, die vor mir hier wohnten: von der Sparkässeli-Diebin an einem Sonntagnachmittag, der traurigen WC-Telefonistin mit dem Döner oder der aufgebohrten Wasserleitung, die eines Tages einen See ins Wohnzimmer gegossen hat – sie sind die Märchen, die dieses Haus erzählen, immer und immer wieder und immer mit leicht abgeänderten Details.
Von den meisten Dingen, die ich über das Haus weiss, weiss ich aber nicht, wie wahr sie sind. Das Haus zu schreiben: heisst das nicht, es zu bewahrheiten?
Fünfter Versuch: Gentri-fiktion/die Sprache des Dings
Ich könnte auch, umgekehrt, mit der Zukunft des Hauses beginnen, denn es steht seit Jahren schon kurz vor dem Abriss. Vielleicht wird es einem Büro weichen, einem Gewerbe oder einem teureren Wohnhaus, wie sie ringsum bereits entstanden sind. Im Zuge der gegenwärtigen Aufwertung ist schon viel Ding aus Schwamendingen gewichen.
Woher kommt das Ding, und wohin geht es? Ursprünglich, im achten Jahrhundert nach Zeitrechnung, hiess «Ding» «Versammlung». Was bedeutet das, «Versammlung»? Ist das eine Sammlung, die – wie ihr Präfix «Ver-» andeutet – irregeführt, sogar irgendwo zugrunde gegangen ist? War das Schreiben des Ding-Hauses vielleicht schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt? Oder muss ich lediglich die Sprache wechseln?
Ich gehe zurück zum französischen «Truc», was neben «Ding» auch «Trick, Täuschung» bedeutet. Trickst mich das Ding-Haus etwa aus? Oder: kann ich das Haus vielleicht nur durch einen Trick schreiben?
Letzter Versuch: der Trick
In einem Zauberschloss
Sind selbst die gewöhnlichsten Kisten
Voller magischer Dinge
Der «Waldgarten», einst als Restaurant und Quartiertreffpunkt im Zürcher Kreis 12 bekannt, ist seit Jahren eine kurzfristige Zwischennutzung – was danach kommt, ist ungewiss. Die Autorin lebt seit dreieinhalb Jahren darin.
Spezialausgabe
Libell 25: so gesehen
Lyenne Palü ist im Jahr 2000 erschienen und in den Rubriken Fine Arts, Gender Studies und Kulturpublizistik zu finden. Gegenwärtiges Eselsohr auf Seite 111, Kapitel „Lost and Found“.