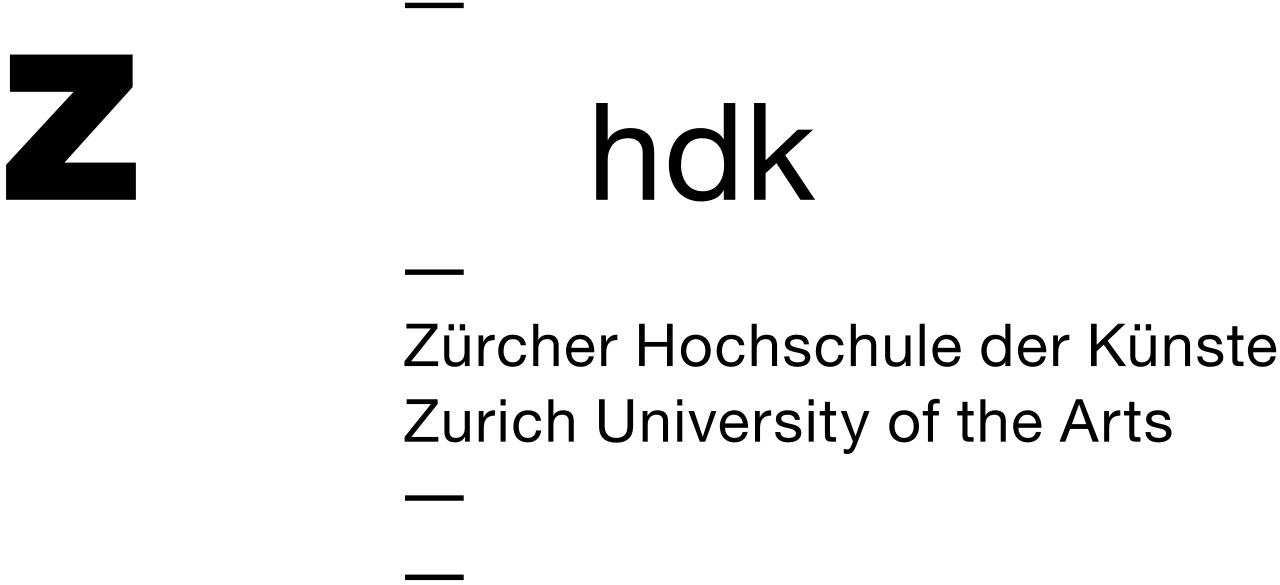Der Kupferblock
Katharina von Zimmern spielte als Äbtissin eine wichtige Rolle in der Zürcher Reformation. Mit einer Blockskulptur wird an sie erinnert. Eine Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Formen des Gedenkens.

Denkmäler nehmen unterschiedliche Formen an: Oft ist es jedoch eine Statue auf einem Sockel, die an eine bestimmte Person oder ein historisches Ereignis erinnern soll. Stolz ragen die Persönlichkeiten auf ihren Plätzen, manchmal bestückt mit machtvollen Symbolen, um ihre Bedeutsamkeit zu unterstreichen. Die Geschichte erhält einen Körper, wird greifbar und nahbar.
Anders verhält es sich mit nicht-figurativen Denkmälern. Sie sind abstrakt und benötigen deshalb mehr Kontext. Die Person selbst ist nicht sichtbar, nur das künstlerische Werk, welches sie repräsentieren soll. Gerade in Bezug auf die Geschlechtsverteilung von figurativen und nicht-figurativen Denkmälern in Zürich gibt es Unterschiede. Während beispielsweise ein Ulrich Zwingli seit 1885 mit Schwert und Bibel in der Hand vor der Wasserkirche steht und so an seine Rolle in der Reformation in Zürich erinnert, wird das Andenken an Katharina von Zimmern – ebenfalls eine wichtige Figur in der Reformation – in einer simplen Blockskulptur im Kreuzgang des Fraumünsters zusammengefasst.
Katharina von Zimmern war die letzte Äbtissin im Fraumünster und gilt als die Person, die ein grösseres Blutvergiessen während der Reformation in Zürich verhinderte. Ihr Denkmal ist das erste der Stadt, das einer FLINTA*-Person gewidmet ist. 2004 enthüllte die Künstlerin Anna-Marie Bauer eine Blockskulptur (ohne Titel), bestehend aus 37 Blöcken und gefertigt aus elf Tonnen Kupfer. Mit Kupfer wird die Göttin Venus bzw. Aphrodite in Verbindung gebracht, da die Göttin laut Überlieferungen in Zypern geboren wurde, wo auch das Erz im Altertum abgebaut wurde. Das Material steht daher symbolisch für Weiblichkeit, gleichzeitig aber auch für Veränderung, weil sich Kupfer leicht bearbeiten lässt. Die Blockformation weist Ähnlichkeit mit einem Altar, Tisch oder Sarkophag auf. Da nicht bekannt ist, wo Katharina von Zimmern begraben wurde und ob sie überhaupt ein Grab hat, kann das Werk auch als Ersatzgrabstätte betrachtet werden. (vgl. Kreis 2012, 203f.).
Mit der Wahl des Materials hat die Künstlerin eine symbolische Verbindung zur Weiblichkeit hergestellt und rückt diese damit dezent in den Fokus. Andere Denkmäler für FLINTA*-Personen stehen zwar als Figur da, sind oftmals aber nackt und ohne Namen. Sie sind vergessen, trotz der «Erinnerung». Katharina von Zimmern bleibt zumindest dieses Schicksal erspart. Ein Schild am Eingang zum Kreuzgang informiert Besucher:innen über den Erinnerungsort, die Person selbst sowie die Künstlerin. Damit ist die abstrakte Blockskulptur in ihrem historischen Kontext verortet und die Rolle der Äbtissin darin nachvollziehbar.
Dennoch: Zwischen Zwinglis Denkmal und dem für Katharina von Zimmern liegen fast 120 Jahre, obwohl beide Personen während desselben historischen Ereignisses tätig waren. Innerhalb dieser Zeitspanne wurde nur an Zwingli erinnert, ein Ungleichgewicht, das die Geschichte lückenhaft darstellt. Der Fokus der Reformation lag auf ihm, bis das Erinnerungsfeld durch das Andenken an Katharina von Zimmern ergänzt wurde, nur anders eben. Die eine Person wurde als Figur dargestellt, die andere nicht.
Vielleicht sind figürliche Denkmäler nicht mehr zeitgemäss, denn 2017 erhielt Hans Künzi ebenfalls ein nicht-figürliches Denkmal am Zürcher Hauptbahnhof beim Zugang vom Europaplatz.
Eine andere Möglichkeit der nicht-figürlichen Erinnerung fand sich 2024 zur Feier von 500 Jahren Reformation in Zürich in Form einer temporären Installation: Der Katharinenturm vervollständigte für einige Monate das Bild des Fraumünsters, welches einst zwei Türme besass. Der 40 Meter hohe Turm bestand aus einem nachhaltig konzipierten Gerüst, der Sockelbereich war begehbar. Bestückt wurde die Installation mit grünen Bändern, welche die Namen von 500 bedeutenden Zürcher FLINTA*-Personen trugen. Diese Form ist bei einer solchen Menge an Personen sinnvoll, sowie die Entscheidung, den verlorenen Turm zumindest kurzzeitig wiederauferstehen zu lassen. Durch das plötzliche Auftauchen der Installation hat diese, und somit auch die Namen der Frauen, viel Aufmerksamkeit erhalten.
Diese Aufmerksamkeit war aber nur von kurzer Dauer, denn die Installation war temporär, und damit auch die Erinnerung an sie, während sich figürliche Statuen von hauptsächlich Cis-Männern weiterhin an ihren festen Plätzen permanent ins Stadtbild einreihen. Aber diese 500 FLINTA*-Personen wurden alle auf einen Schlag symbolisch abgehakt. Ein Vermächtnis soll vermeintlich ewig andauern, doch anscheinend gilt dies nicht für FLINTA*-Personen.
Anhand von Katharina von Zimmerns Denkmal lässt sich ein Diskurs zu den Formen des Gedenkens öffnen. Die Vergangenheit hat figürliche Statuen hervorgebracht, abstrakte Skulpturen scheinen der Trend der Gegenwart zu sein, und das Erinnern der Zukunft könnte erneut anders aussehen.
Erinnern kann und soll sich in seiner Form und Materialität unterscheiden. Je nach Person und Kontext eignen sich verschiedene Gestaltungsweisen. Aber das Ungleichgewicht der Geschlechtsverhältnisse im Stadtbild muss nachhaltig ausgeglichen werden. Die Geschichte wurde von einer Geschlechtervielfalt geprägt und sollte sich auch so im Stadtbild widerspiegeln. Denn auch FLINTA*-Personen sind es wert, dass nachfolgende Generationen sich an sie erinnern.
Katharina von Zimmern war die letzte Äbtissin im Fraumünster. Ihre Entscheidung, dass Fraumünster an die Reformator:innen abzugeben, verhinderte einen Bürgerkrieg während der Reformation. 2004 wurde sie mit einer Blockskulptur geehrt. Die Autorin hat diese Form des Gedenkens genauer untersucht.
Literatur:
Kreis, Georg: Die öffentlichen Denkmäler der Stadt Zürich. Ein Bericht von Georg Kreis im Auftrag der Arbeitsgruppe KiöR. Juni 2012. https://www.stadt-zuerich.ch/de/aktuell/publikationen/2021/bericht-denkmaeler-georg-kreis.html [Zugriff: 31.03.2025]
Spezialausgabe
Libell 25: so gesehen
Laura Carluccio (1999*) lebt in Thun, ist Studentin des Master Kulturpublizistik an der ZHdK und schreibt Filmkritiken auf Letterboxd.