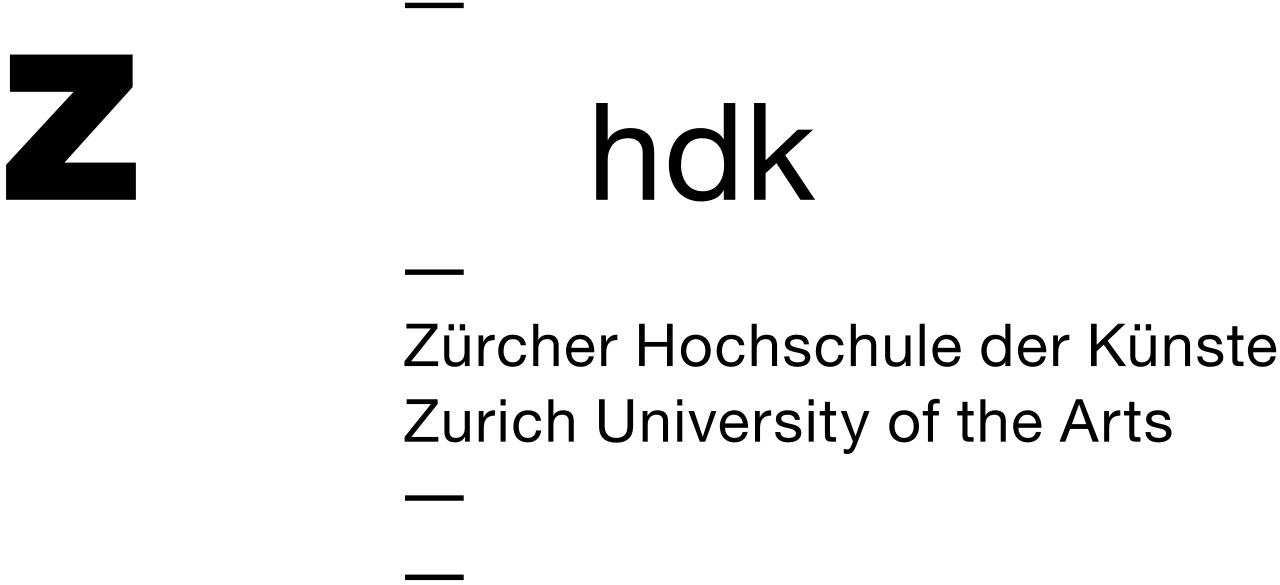«Benutzer Nr. 814»: James Joyce und Zürich
Zürich, ein Ort, der für viele Künstler:innen und Denker:innen zur letzten Station wurde – darunter auch James Joyce. Vom Platzspitz bis zum Friedhof Fluntern: In der Limmatstadt gibt es einige Orte, die an den irischen Schriftsteller erinnern. Ein Spaziergang auf seinen Spuren.

Von Weitem ist seine Gestalt zu erkennen. Die Schultern leicht gebeugt, ein aufgeschlagenes Buch in der Rechten. Eine Pose, mehr Symbol als Realität, denn so hält kein Mensch ein Buch. Der Blick scheint sich auf die Besuchenden zu richten, aber die Brillengläser lassen keine Augen erkennen. Gerade erst, so scheint es, hat er sich niedergelassen – den Gehstock locker zur Seite gelehnt, eine Zigarette in der linken Hand, halb heruntergebrannt. Was fehlt: der ikonische Filzhut. Vom Wind erfasst? Nach dem Aufstieg auf den Zürichberg abgenommen? Wir werden es nie erfahren.
Mors certa, hors incerta – der Tod ist gewiss, nur die Stunde bleibt unbekannt. Vielleicht müsste ergänzt werden: Auch der Ort bleibt meist ungewiss. Nur selten ist es unsere Entscheidung, wo das Leben endet. Und doch gibt es Städte, die sich über die Jahrzehnte hinweg still und beharrlich als letzte Station ins kollektive Gedächtnis eingeschrieben haben. Nicht, weil dort mehr gestorben würde als anderswo – sondern weil sich dort das Ende grosser Lebensläufe verdichtet hat. Zürich ist eine solche Stadt.
In Zürich liegen viele, die nie Zürcher:innen waren. Zwischen Vormärz und Drittem Reich wurde die Stadt für zahlreiche Verfolgte zum Zufluchtsort und letzten Aufenthaltsort. Hier endeten Lebenswege, die andernorts nicht mehr gangbar waren. So wurde Zürich, wie Thomas Mann es nannte, zum «Sterbeland deutscher Dichter» – und zum «Kulturfriedhof Europas», wie Paul Nizon spottete. Viele kamen auf der Flucht – und blieben für immer.
Im Umgang mit prominenter Vergänglichkeit hat Zürich also Erfahrung. Wer durch die Friedhöfe streift, begegnet Thomas Mann, Mascha Kaléko, Georg Büchner, Gottfried Keller und vielen weiteren – ein intellektuelles Bestattungsensemble ersten Ranges.
Einer der bekanntesten unter ihnen: James Joyce. Dass der irische Schriftsteller (1882–1941) einmal in Zürich begraben liegen würde, hätte er selbst wohl kaum erwartet. Zwar war ihm die Stadt vertraut – er lebte hier während des Ersten Weltkriegs mit seiner Frau Nora Barnacle und den gemeinsamen Kindern, suchte Zuflucht, fand Ruhe –, doch ab 1920 verlegte die Familie ihren Lebensmittelpunkt nach Paris. Erst als die Wehrmacht 1940 in Frankreich einmarschierte, strebte der inzwischen weltberühmte Autor zurück nach Zürich.
Die Rückkehr war jedoch alles andere als einfach: Die kantonale Fremdenpolizei verweigerte zunächst die Einreise. Es bedurfte monatelanger Verhandlungen, energischer Fürsprache durch Freund:innen, der Unterstützung des damaligen Stadtpräsidenten – und einer hohen Kaution –, bis Joyce und seine Familie schliesslich ein Visum erhielten. Drei Wochen später stirbt Joyce in einem Zürcher Krankenhaus an den Folgen einer Darmoperation.
Er blieb. Und sitzt nun – zumindest symbolisch – auf einem Sockel des Friedhofs Fluntern. Die 1966 errichtete Bronzeplastik zeigt Joyce rauchend, lesend, nachdenklich. Ein Denkmal des Exils, des Zufalls, der Endstation.
Doch Zürich ist nicht nur Joyces letzte Adresse. Die Stadt bewahrt bis heute seine Spuren. Dass Ulysses teilweise in Zürich entstand, dürfte das intellektuelle Selbstwertgefühl der Stadt nachhaltig gestärkt haben. Joyce, so verkündet es die Zentralbibliothek nicht ohne Stolz, war Benutzer Nr. 814. In aller Stille lieh er sich Bücher zur Odyssee aus, während draussen die Tram quietschte und drinnen sachliches Schweigen herrschte.
Fritz Senn, Wächter des Joyceschen Erbes und Leiter der Zürich James Joyce Foundation, weist auf zarte Bleistiftspuren in einem der Bände hin. Ob Joyce selbst sie hinterliess, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Und doch umweht die Idee, Joyce selbst habe dort seine Gedanken hinterlassen, eine eigene Faszination. Wer die Linien wirklich zog, ist letztlich unerheblich.
Im James Joyce Restaurant kann heute im viktorianischen Ambiente gespeist werden – irisch, versteht sich, aber mit Zürcher Preisaufschlag. Alternativ führt der Weg in die Kronenhalle, in der Joyce einst verkehrte. Der «Joyce-Tisch», ein Vierertisch rechts vom Eingang, ist Kulturgut. Ein Denkmal mit Serviette. Ein Porträt des Schriftstellers von Cuno Amiet blickt streng am Eingang herab – das geistige Äquivalent zur Michelin-Plakette.
An der Universitätsstrasse 38 hängt eine Gedenktafel. Einer von vielen Wohnorten der Familie Joyce, die sich, geplagt von chronischem Geldmangel, durch das städtische Mietangebot improvisierte. Allein im Quartier Seefeld beziehen sie vier verschiedene Bleiben.
Ausserdem flanierte Joyce – so wird zumindest gesagt – regelmässig über den Platzspitz-Park. Die spitz zulaufende Mittelinsel, an deren Ende sich Limmat und Sihl vereinen, war damals ein Naherholungsort. Heute tummeln sich picknickende Menschen auf den säuberlich-schweizerisch eingegrenzten Rasenflächen, doch die Erinnerung an den irischen Schriftsteller wird dort überlagert von dunkleren Kapiteln – der offenen Drogenszene der 1990er-Jahre.
Vielleicht gerade deshalb der Versuch zur literarischen Ehrenrettung: 2004 liess die Zürich James Joyce Foundation stilisierte Metallbuchstaben an der Platzspitzmauer anbringen – «Ljmmat» und «Sjhl». Ein subtiles Spiel mit den Initialen des Schriftstellers, hineinkomponiert in die Topografie. Poetisch gedacht, ästhetisch solide – doch ob das nun wirklich ein literarisches Denkmal ist oder doch nur gut gemeinte Urbanistik mit Bildungsauftrag, bleibt offen.
Immerhin: Joyce erwähnte beide Flüsse in Finnegans Wake, jenem Werk, das mehr Rätsel als Lektüre ist. «Yssel that the limmat?» fragt es dort, und «legging a jig or so on the sihl» wird getanzt. Auch das «Neederthorpe» (Niederdorf), die «sillypost» (Sihlpost) und die «saxy luters» (Sechseläuten) finden sich im Text. Zürich, gut getarnt, versteckt sich in den Seiten dieses literarischen Labyrinths.
Hier der Park, dort die Bahnhofstrasse, wo ein Hexenschuss zur lyrischen Intervention wurde. In seinem Gedicht Bahnhofstrasse verarbeitete Joyce den Schmerz – Zürich als physischer und poetischer Reizpunkt.
Und dann war da noch diese Sache mit der Sauberkeit. Joyce, der sich an den Grossstadtmief von Triest und Paris gewöhnt hatte, sagte über die Zürcher Ordnung: «If you spilled minestra on the Bahnhofstrasse you could eat it right up without a spoon.» Eine schweizerische Liebeserklärung, wie sie im Buche steht.
Am 13. Januar 1941 wurde James Joyce auf dem Friedhof Fluntern in Grab 1449 beigesetzt. Ein Priester? Nicht anwesend. «Das kann ich ihm nicht antun», entschied seine Witwe Nora Barnacle.
In der Limmatstadt, bekannt für ihre hohe Lebensqualität, wird auch das Sterben nicht dem Zufall überlassen. Selbst der Abschied geschieht hier auf bemerkenswert hohem Niveau. Die städtischen Friedhöfe – oft mit einem Ausblick gesegnet, der selbst manch luxuriösem Anwesen an der Goldküste Konkurrenz macht – präsentieren sich als stille Oasen.
Mit seiner Lage oberhalb der Stadt, nahe dem Zoo, bietet der Friedhof Fluntern einen weiten Blick über Zürich. Von all den Ruhestätten prominenter Persönlichkeiten, die Zürich bewahrt, ist es jene von Joyce, die heute am häufigsten aufgesucht wird, schreibt Daniel Foppa in Berühmte und vergessene Tote auf Zürichs Friedhöfen, und die Bronzestatue am Grab Joyces ist längst zu einem Wahrzeichen geworden.
«An Joyces Grab verweht die Menschensprache», dichtete einst Yvan Goll. Möglich. Hier, zwischen den Steinen, scheint das Verstummen greifbar, das jenen folgt, deren Worte einst Welten bedeuteten. Zwischen den Gräbern herrscht eine stille Gleichheit: Ob prominent oder namenlos, alle sterben. Berühmtheit hilft zwar bei der Grabpflege, aber nicht bei der Sterblichkeit.
All diese Orte sind keine Sehenswürdigkeiten im eigentlichen Sinn. Sie sind Leerstellen im Stadtbild, Zäsuren im Stadtlärm. Diese Orte laden nicht zum Staunen ein, sondern zum Spüren. Und vielleicht auch dazu, sich ein wenig Genius einzuhandeln – auf literarischem Wege, durch physische Nähe, durch rituelles Flanieren. Denn wer auf den Spuren der Toten wandelt, sucht letztlich auch sich selbst. Kurt Tucholsky wusste das längst: «Man besucht ja nur sich selber, wenn man zu den Toten geht.»
Zürich ist nicht nur für seine hohe Lebensqualität bekannt, sondern auch als letzte Ruhestätte für Persönlichkeiten von Weltrang. Die Autorin folgt den Spuren berühmter Schriftsteller:innen und begibt sich in fremden Städten auf die Suche nach ihren letzten Aufenthaltsorten.
Spezialausgabe
Libell 25: so gesehen
Philomena Grütter (1997*) wohnt in Basel, ist Studentin des Master Kulturpublizistik an der ZHdK, Redaktionsleiterin des Magazins bebbi zine und arbeitet am Theater Basel als Künstlerische Produktionsleiterin.