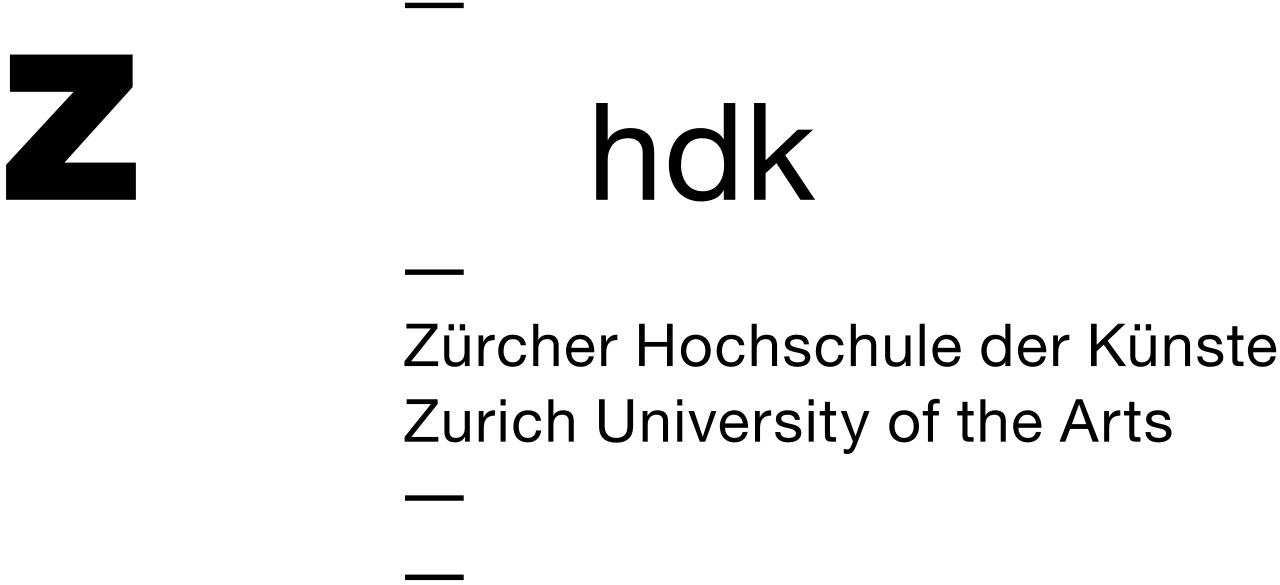Zürich, erstes Obergeschoss
An der Rosengartenstrasse taucht ein Betongigant auf: Die Hardbrücke. Unsere Autorin widmet sich fabulierend einem Lieblingsmonument ihrer Wahlstadt.

Die Strasse reichte nicht mehr aus. Es musste angebaut werden – in die Höhe. Mitten in der Stadt glitten bald Lifts auf und ab. Die Strasse hatte sich zum Erdgeschoss und der Überbau zum ersten Stock gewandelt. Wer schneller sein wollte, wer schneller sein musste, nutzte die neu aufgesetzte Überführung.
An der Rosengartenstrasse wuchtet sich ein Betongigant aus dem Boden. Auf Säulen ruht er über Strasse und Fluss. Er fasst sich staubig trocken an, die grau-melierte Oberfläche ist mit millimeterkleinen Löchern gespickt, in regelmässigen Abständen ziehen sich dunkle Nähte durch den Stein, dort, wo er aneinandergeklebt sein muss. Vierspurig fahren Autos darüber, an einem Dienstagnachmittag im April sind es 50 in der Minute. Sie wollen von Norden nach Süden, sie wollen von Süden nach Norden, das Gummi ihrer Reifen reisst sich klebrig vom Asphalt. Drei Buslinien surren in zwei Richtungen, mit einem Metallbügel tasten sie sich an der Oberleitung entlang. Einen Fussgänger:innenstreifen gibt es hier nicht. Das sind die ersten von 1350 Metern Nord-Süd-, Süd-Nord-Beton.
Wäre diese Brücke aus Wolle, gestrickt oder gehäkelt, würde sich das Gewicht der Überquerenden bald in der Mitte konzentrieren. Dort, vielleicht auf Höhe des Schiffbau, würde die Strick-Brücke dann herabhängen, weil die Wolle das Gewicht nicht gleichmässig tragen könnte. Die Menschen lägen übereinander und würden versuchen, sich aus der Menge zu befreien, um pünktlich zur Arbeit zu kommen. Sie würden mit ihren Fingerspitzen in die Wollmaschen greifen, die, so stark gespannt, in ihre Fingerkuppen schneiden würden, bis sie weiss werden. Wenn sie sich herausgezogen hätten, würden sie auf Knien und Händen über die Brücke krabbeln und mit jeder Bewegung tief im Brückengewebe einsinken. Ihre Rucksäcke würden ihnen von den Schultern über den Kopf rutschen. Die Trinkflaschen würden von der Schwerkraft aus den seitlichen Halterungen gezogen und von den Wollmaschen aufgefangen werden. Manche Trinkflaschen würden durch die Brückenmaschen rutschen und zehn Meter in die Tiefe fallen. Am Schiffbau und Escher-Wyss-Platz hingen anstelle der Lifts und Wendeltreppen dick gehäkelte Wolltaue, an denen sich die Menschen schliesslich herabseilen müssten, um in ihre Büros zu gelangen. Um Sicherheit zu gewährleisten, würde ein Mitarbeiter vor dem Abstieg Helme verteilen. Er würde auch die Sicherheitsanweisung übernehmen und die Menschen darauf hinweisen, dass sie das Tau nicht hinabrutschen dürften, sondern es mit ihren Händen abwechselnd abgreifen müssten, um Verbrennungen zu vermeiden. Wäre diese Brücke aus Wolle, müssten die Menschen doppelt so viel Zeit für ihren Arbeitsweg einplanen.
Am Escher-Wyss-Platz hat die Brücke ihre finale Höhe erreicht. Sie spannt sich am unübersichtlichen Knotenpunkt als flächiges Dach auf, lässt weder Regen noch Sonne auf den Asphalt. Hier, wo auf Strassenlevel Autos, Trams, Velos und Fussgänger:innen um den Vorrang kämpfen und ein weiss gestrichenes Velo, umringt von Kerzen, mahnend an einem Pfahl lehnt, winden sich zwei ausladende Beton-Wendeltreppen um zwei Liftkerne in die Höhe – und überbrücken das Chaos. Oben gibt es nur zwei Richtungen: Nord und Süd. Auch die Tramlinie 8 klettert seit einigen Jahren zur Haltestelle Bahnhof Hardbrücke hinauf, um ihre Passagier:innen abzusetzen, abzuholen und dann direkt wieder auf Strassenlevel zurückzukehren. Die absolute Feinjustierung des Strassenverkehrs – hier, wo sich der Himmel im Prime Tower spiegelt, wird sie noch geschätzt, die Millisekunde.
Wäre diese Brücke ein Tunnel, würde die Strasse zum Erdgeschoss und der Tunnel zum ersten Untergeschoss. Die Tasten im Lift würden geändert in 0 und –1. Der Asphalt auf dem Escher-Wyss-Platz würde seit Jahren zum ersten Mal vom Regen gewaschen und von der Sonne getrocknet werden. Im Tunnel würde dann kein Bus fahren, sondern eine Bahn, die in wenigen Millisekunden auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigt. Die Haltestellen zwischen Rosengartenstrasse und Bahnhof Hardbrücke müssten aufgelöst werden, der Effizienz halber. Unter der Rosengartenstrasse würde die Bahn sich aufladen und dann mit einem Ruck durch den Tunnel nach vorne schiessen, die Passagier:innen müssten sich aus Sicherheitsgründen anschnallen. Innerhalb von zehn Sekunden wäre die Bahn am Bahnhof Hardbrücke, der unterirdisch begehbar wäre. Läge diese Brücke zwei Stockwerke tiefer, wäre diese Brücke also ein Tunnel, bliebe der Berufsverkehr unsichtbar. Den Sonnenuntergang über dem Gleisbett sähe dann auch niemand mehr.
Nach 1350 Metern ebnet sich der Beton gleichmässig, bis er im Hardplatz verschwindet. Von der Rosengartenstrasse bis hierher hat es nur etwas über eine Minute gedauert. An der gegenüberliegenden Ampel in der Hardstrasse wartet der nächste Bus, warten die nächsten Autos geduldig, bis sie hier auffahren können, ihrerseits von Süden nach Norden. Die Fahrzeuge von Norden halten sich die Waage mit den Fahrzeugen von Süden. Fährt eines hinab, fährt das nächste hinauf. Der Beton wird nie allein sein.
Wäre das erste Obergeschoss irgendwann überlastet, müsste die Projektplanung für das zweite Obergeschoss beginnen. Kernidee des Vorhabens wäre der erste Auto- und Busaufzug im Schweizer öffentlichen Verkehr. Am Hardplatz und an der Rosengartenstrasse würde er die Fahrzeuge in einen zweiten Stock fahren, wo sie ungestört 1350 Meter nach Süden oder Norden fahren könnten, sogar schneller als im ersten Obergeschoss, um dann wieder mit dem Aufzug auf Strassenlevel zurückzukehren. Es wäre ein verkehrsplanerischer Durchbruch.
Eine erste Hardbrücke existierte schon 1897 – so, wie die Brücke heute aussieht, gibt es sie erst seit 2017. Nachdem die Autorin sie in dreien ihrer Texte erwähnt hatte, war es Zeit, ihr eine eigene Arbeit zu widmen.
Spezialausgabe
Libell 25: so gesehen
Johanna Brodmann (1998*) ist Studentin im Master Cultural Critique – Kulturpublizistik an der ZHdK. Zuvor studierte sie in Hildesheim, Paris und Leipzig Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis sowie Filmwissenschaften.